|
|
||||||||||||||||||||||||
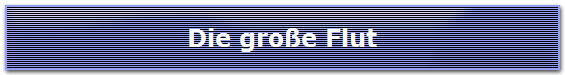 |
|
|
|
Die Sache ist ja nicht ganz billig. Die Kurzarbeit und die Konjunkturprogramme haben gewaltige Löcher in die öffentlichen Haushalte gerissen. Dazu gab es keine Alternative. AuÃer einen dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit. In der Wirtschaftspresse wird in diesen Tagen über Geld und Währungen diskutiert. Henrik Müller ist stellvertretender Chefredeakteur des Manager Magazins, Thomas Fricke Chefredakteur der Financial Times Deutschland. Müller ist Monetarist, Fricke Keynesianer. In der Dezember-Ausgabe des Manager Magazins sieht Henrik Müller die globale Wirtschaft âauf dem Weg zur Weltwährungskriseâ, so der Titel seines Kommentars. Er steht leider (noch) nicht im Internet; nach Weihnachten dürfte er hier zu finden sein. Ãblicherweise stellen wir uns Rezessionen als reinigende Gewitter vor, die all den Schmutz wegspülen, der sich in der hitzigen Phase zuvor angesammelt hat. Doch danach sieht es dieses Mal nicht aus. Immer noch, das ist der Kern des Problems, schwappt zu viel Geld durch die Welt. Sollten Sie bislang noch keine genaue Vorstellung vom Monetarismus gehabt haben, hier haben Sie das Musterbeispiel: âzu viel Geldâ. Es ist immer zu viel Geld da â in der monetaristischen Vorstellungswelt. Da âschwapptâ das Geld nur so. Die Staatsverschuldung ist zu hoch, die Inflation droht usw. usf. â immer. Die Ãberschussliquidität tut längst ihre Wirkung. An den Finanzmärkten Die Sprache ist etwas merkwürdig. Ein Bond ist eine Staatsanleihe, ein Bond-Bubble folglich eine Spekulationsblase auf den Rentenmärkten. Zwar lässt sich auch direkt mit Devisen spekulieren, was auch munter geschieht, inklusive der entsprechenden Blasenbildungen, aber es ist klar, dass der Kurs einer Staatsanleihe in enger Korrelation zum Devisenkurs des jeweiligen Landes steht. Während der Monetarist ein Anhänger eines starken Euro ist â wobei: auch ein starker Euro bietet nur scheinbar Sicherheit -, sorgt sich der Keynesianer um die Wettbewerbsposition der Volkswirtschaft. Thomas Frickes Kommentar heiÃt âGemeingefährliche Devisenspieleâ, und das ist die Einleitung: Die Finanzkrise hat tektonische Verschiebungen der globalen âMarktdemenzâ â sehr schön, muss ich mir merken. Manipulation? Wie auch immer: auf jeden Fall die Spekulation â auf den Devisenmärkten wie auf den Bondmärkten. Armes Deutschland! Hä? â Ja sicher, auch andere Nationen im âEurolandâ haben den Euro, und ohne den Euro wäre die deutsche Währung (D-Mark) schon längst unter die Decke geknallt, aber es stimmt ja (Fricke ist nur ein kleines nationales Versehen unterlaufen): Die Rechnung zahlen jene, die nach allen Manipulationen und Marktversagen hochgehandelt werden. Zum Beispiel die Deutschen, die so zu späten GroÃverlierern der Krise zu werden drohen. Nach OECD-Schätzung müsste der Euro 1,16 $ kosten, wenn er, wie es ökonomisch sinnvoll wäre, transatlantische Kaufkraftunterschiede ausgliche. Jetzt liegt er bei 1,50 $. Sprich: Euro-Waren und -Arbeitskräfte sind allein devisenkursbedingt im Ausland fast 30 Prozent zu teuer. Da fliehen jetzt halt Betriebe, ⦠wie die gerade angekündigte Verlagerung von Teilen der Mercedes-Produktion ins Dollar-schwache Amerika erahnen lässt. Ja, die Amerikaner. Oder auch die Briten: Bis zum Ausbruch der Krise lag das britische Pfund bei 1,50 Euro â jetzt sind es nur noch gut 1,10 Euro. Deutsche Exporte nach GroÃbritannien sind damit rechnerisch fast 40 Prozent teurer als vor zweieinhalb Jahren. Im Schnitt hat die britische Währung weltweit ein Viertel abgewertet. Also kommt Thomas Fricke zu dem Schluss: Es wäre höchste Zeit, über ein neues Weltwährungssystem Ich sinniere und sinniere. Ãber ein neues Weltwährungssystem. Feste Wechselkurse à la Bretton Woods? - Nicht ganz so neu. Eine Welteinheitswährung? â Gern, doch scheint mir die Zeit noch nicht reif für den âGloboâ zu sein. Und was schlägt Henrik Müller vor, der monetaristische Gegenspieler? â âZinsen rauf, und zwar schnell!â So brillant die Analysen der beiden Wirtschaftsexperten, so unbrauchbar deren Vorschläge. AuÃerdem: die beiden Analysen widersprechen sich im Kern gar nicht. Es ist zu viel Geld unterwegs. Geld, das eben nicht in den Konsum oder in Investitionen geht, sondern in die Spekulationsblasen hineinflutet. Werner Jurga, 14.12.2009 |
|
|
|
|
| [Jurga] [Home] [März 2010] [Marxloh stellt sich quer] [Februar 2010] [Januar 2010] [2009] [Dezember 2009] [November 2009] [Oktober 2009] [September 2009] [August 2009] [Juli 2009] [Juni 2009] [Mai 2009] [April 2009] [März 2009] [Februar 2009] [Januar 2009] [2008] [2007] [Kontakt] |
